Bürgerinitiative Liebenau
Aktivitäten
Webseite der Bürgerinitiative Liebenau gegen die Errichtung einer Verarbeitung und Halde in Liebenau
Argumente und Einwände zur Raumverträglichkeitsprüfung der Planungen der Lithium Zinnwald GmbH

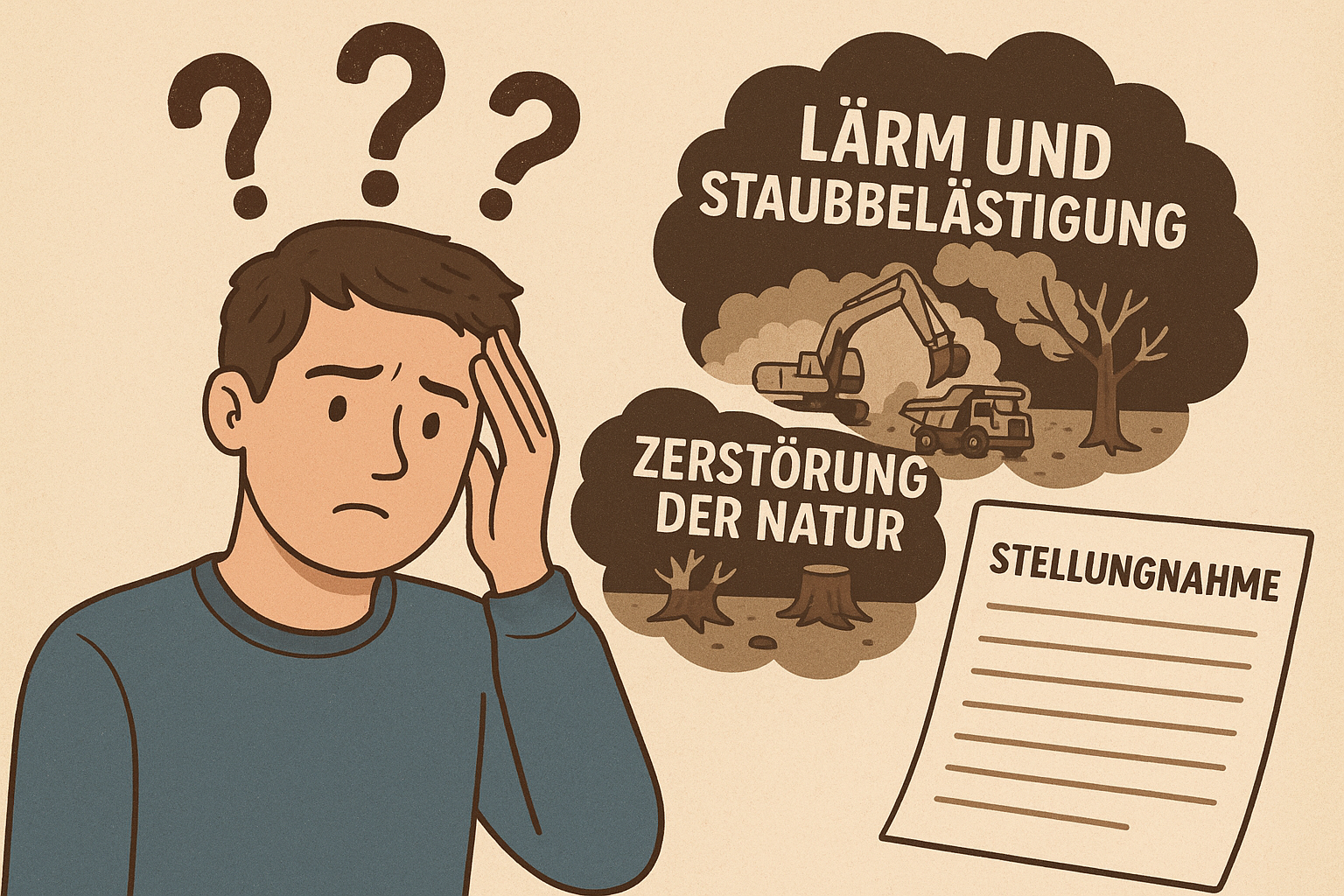
Ihr wollt eure Stellungnahme abgeben, habt aber noch keine Idee, was ihr inhaltlich thematisieren könnt? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch. Im Folgenden könnt ihr euch zu essenziellen Kritikpunkten des geplanten Vorhabens belesen. Bitte seht das ganze nur als Informationssammlung an und schreibt die Stellungnahme mit euern eigenen Worten.
Die Aufbereitung des lithiumhaltigen Gesteins geschieht unter hohem Wasserverbrauch. Zusätzlich wird Wasser zur Staubbindung und als Löschwasser für eventuelle Havarien gebraucht. Es steht zu befürchten, dass die Raffinerie und der Lithium-Abbau die Wasserversorgung in unserer Region und damit eine Lebensgrundlage ihrer Bewohner gefährden.
Mehr Informationen
Der in den Planungsunterlagen angegebene Bedarf an Prozesswasser der Aufbereitungsanlage
beträgt 143 m³/h oder 1,25 Mio m³/a pro Jahr. Zur Deckung dieses Bedarfs soll die Entwässerung
des Bergwerks und des zu bauenden Tunnels dienen. Als Vergleichspunkte können die
Durchflussmengen des Roten Wassers und der Müglitz (Pegel vor dem Hochwasserrückhaltebecken
Lauenstein) dienen:
| Müglitz, Pegel vor dem HRB Lauenstein |
Rotes Wasser, Pegel Geising |
|
| Durchfluss, Durchschnitt |
29 | 144 |
| Durchfluss, Minmalwert |
11 |
93 |
(Angaben in m3/h; Messwerte laut Pegelportal Sachsen und Landestalsperrenverwaltung in den ersten 17 Tagen
der Veröffentlichung der RPV-Unterlagen: in m3/h, Zeitraum von 20.06.2025 bis 06.07.2025)
Im angegebenen Zeitraum betrug der durchschnittliche Durchfluss der Müglitz also 29 m³ pro
Stunde, wobei an 6 Tagen in diesem Zeitraum nur 11 m3 pro Stunde gemessen wurden. Der
Durchfluss des Roten Wassers in Geising betrug 144 m3/h, wobei an 11 Tagen in diesem Zeitraum
nur 93 m³/h gemessen wurden.
Laut diesen Daten beansprucht das Lithiumprojekt eine Wassermenge, die der gesamten
Durchflussmenge des Roten Wassers in Geising in den Sommermonaten vergleichbar ist, und damit
einen wichtigen Teil des verfügbaren Oberflächenwassers der Region.
Können diese Wassermengen durch die Zinnwald Lithium GmbH genutzt werden, ohne die
Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft und die Pegelstände der Flüsse zu gefährden?
Wir befürchten eine Übernutzung der Wasserressourcen. In der Unterlage C, Seite 125, wird
festgestellt, dass der Wasserbedarf von 143 m³/h bei weitem nicht den gesamten Bedarf darstellt.
Es heißt dort: „Zusätzlich kann ein Wasserbedarf durch Anforderungen zur Löschwasserbereit-
stellung und zur Minderung von diffusen Staubemissionen entstehen.
Für eine weitere Wasserbereitstellung können u.a. die Sammelbecken Lauenstein und Gottleuba
genutzt werden.“
Außerdem wird dort angegeben, dass Wasser „aus Flüssen“ abgepumpt werden kann. Es werden
also erhebliche Mengen zusätzlichen Wassers für den Betrieb der Anlage benötigt, deren Umfang in
den Unterlagen nicht ausgewiesen ist.
Die geplante Halde muss fortwährend bewässert werden, um Staubverwehungen zu verhindern.
Gleiches trifft für die Wege und Straßen im und um das Werksgelände zu.
Im Brandfall müssen außerdem große Löschwassermengen schnell zur Verfügung stehen, die es
bisher in Liebenau nicht gibt.
Das geplante Abpumpen von Wasser aus den Flüssen ist insofern problematisch, als durch den
geplanten Tunnel die Einzugsgebiete der Flüsse bereits entwässert werden.
Ohnehin werden die Pegelstände also sinken. Zusätzliche Wasserentnahmen werden schwer
möglich sein. Das Hochwasserrückhaltebecken Lauenstein stabilisiert den Abfluss der Müglitz
und verhindert deren Austrocknung in den Sommermonaten.
Mit einem Gesamtstauraum von ca. 5,81 Mio m³ und einer Mindestfüllung von ca. 3%
Betriebsvolumen von 0,174 Mio m3 wäre es bei einer permanenten Wasserentnahme, bei
gleichzeitig lang anhaltender Trockenheit in geplantem Umfang auch in wenigen Wochen (ca. 50
Tage) leergepumpt.
Die Trinkwasser-Talsperre Gottleuba ist nicht einfach nur ein Sammelbecken, wie von ZL
dargestellt.
Die Trinkwasser-Talsperre Gottleuba steht untrennbar in Verbindung mit dem einige hundert
Meter unterhalb der Stauanlage liegenden Wasserwerk Gottleuba, das über zwei
Stahlrohrleitungen Wasser aus der Talsperre erhält.
Zu ihm gehört auch ein 42 Kilometer langes Ableitungssystem. Im Schnitt werden 170 Liter pro
Sekunde an das Werk abgegeben. In Spitzenzeiten können hier täglich bis zu 33.000 Kubikmeter
Wasser aufbereitet werden. Damit werden mehr als 150.000 Menschen im Landkreis Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge und in Dresden mit Trinkwasser versorgt.
Die Trinkwasser-Talsperre Gottleuba muss für eine industrielle Nutzungen tabu sein.
Neu anzulegende Brunnen in Liebenau würden zur Grundwasserabsenkung führen. Eine
Abschätzung, wo und wie sich der erhebliche zusätzliche Wasserverbrauch auf den Naturraum des
Ost-Erzgebirges auswirken wird, liefern die Unterlagen nicht.
Durch den geplanten Bau eines Tunnel zwischen Zinnwald-Georgenfeld und Liebenau erfolgt ein
Grundwasseranschnitt. Damit wird dem Grundwasserkörper der Müglitz pro Betriebsjahr dauerhaft
Grundwasser in der Größenordnung von ca. 730.000 m³/a entzogen. Durch den
Grundwasseranschnitt des Gebirgsgrundwasser durch das Bergwerk werden dem
Grundwasserkörper der Müglitz pro Jahr weiter ca. 300.000 m³ Wasser entzogen.
In Summe werden dem Grundwasserkörper der Müglitz also dauerhaft in der Betriebszeit des
Bergwerkes und des Tunnels pro Jahr ca. 1 Mio m³ Grundwasser entzogen.
Die Grundwasserneubildung des Grundwasserkörpers der Müglitz (GWK) beträgt nach eigenen
Angaben von ZL ca. 16 Mio m³/a. D.h. die Grundwasserneubildung wird dauerhaft um ca. 6 bis
6,5% pro Jahr verringert.
Es ist davon auszugehen, dass durch die o.g. Grundwasseranschnitte, und auch durch die
Unterbrechung natürlicher Klüfte, Quellen versiegen und Brunnen trocken fallen werden.
Ein besonderes Augenmerk ist auf Löwenhain zu richten:
Da Löwenhain ein Brunnendorf ist, wo keine Trinkwasserleitung besteht, bedroht das
Lithiumprojekt direkt seine Bewohnbarkeit.
Insgesamt ist festzuhalten, dass das gesamte Untersuchungsgebiet der Raumverträglichkeitsprüfung
im Bereich der Grundwasserkörpers der Müglitz liegt, insofern sind alle Orte, in denen die
Hauswasserversorgung noch durch eigene Brunnen erfolgt, unmittelbar betroffen, also
beispielsweise auch Fürstenau, Fürstenwalde und Gottgetreu-Müglitz.
Das Unternehmen ZL gibt aktuell einen Gesamtwasserbedarf von ca. 1,3 Mio m³/a pro Jahr an.
Zum Vergleich:
Zinnerz Altenberg hat in seinem besten Jahr 1988 für die Aufbereitung von ca. 1 Mio t/a Rohrerz
über 8 Mio m³/a Wassergebrauch gehabt, davon ca. 4 Mio m³ Frischwasser und Grubenwasser und
4,5 Mio m³/a waren sogenanntes Rückwasser, also Wasser, was mehrfach aufbereitet und genutzt
wurde.
ZL will nunmehr pro Jahr 1,5 Mio t/a Roherz aufbereiten. Später gegebenenfalls sogar die doppelte
Menge.
Es wird das gleiche Gestein lediglich nach einem anderen Stoff (Lithium statt Zinn) suchend,
aufbereitet.
Das von ZL genannte „Sulfatierungsverfahren“ ist auch ein nass-chemisches Verfahren. Es wird in
den unterschiedlichen Prozessschritten Wasser hinzugefügt, entzogen (auch verdampft), es wird
gefiltert und gereinigt, es wird mit Wasser gekühlt, es wird verdunstet, es wird eingedickt usw. usf.
Alles Prozesse, die immer mit erheblichen Wasserverlusten und Bedarf an „neuem“ Wasser
einhergehen.
Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ZL bei einer um 500.000 t/a größeren Roherzmenge pro
Jahr mit einem Siebentel oder ca. 14% das Wasserbedarfes der Zinnerz Altenberg auskommen, und
den gigantischen Wasserbedarf der Aufbereitungsanlage decken will.
Konkrete nachvollziehbare Zahlen, wie bspw. Frischwasserbedarf und Grubenwasserbedarf und
genaue Mengen von sogenanntem Rückwasser nennt ZL nicht.
Es wird immer wieder nur von einem (vmtl. immerwährenden Kreislauf) von Prozesswasser ohne
zusätzlichen Wasserbedarf geschrieben.
Gleichzeitig nennt ZL in Unterlage B unter
2.6 Infrastruktur und Erschließung
Tabelle 3: Potenzielle Wasserverfügbarkeit Liebenau [3]
Potentielle Quellen für weiteren Wasserbedarf in Summe in der Größenordnung von ca. 5,2 Mio
m³/a pro Jahr.
Zusammen mit dem von ZL bereits genannten ca. 1,3 Mio m³/a Wasserbedarf pro Jahr ergeben sich
dann ca. 6,5 Mio m³ Wasserbedarf. Die Wahrheit, die ZL nicht nennt, wird irgendwo dazwischen
liegen und damit vmtl. etwa bei 50 bis 60% des Wasserbedarfes der Zinnerz Altenberg.
In den weiteren Planung von ZL mit einer Verdoppelung das Rohrerzabbaus auf ca. 3,2 Mio t/a pro
Jahr wird sich auch der Wasserbedarf der Aufbereitungsanlage, aber auch des Bergwerkes
verdoppeln.
Dies alles gefährdet damit eine Lebensgrundlage der Anwohner. Dem kann raumordnerisch nicht
zugestimmt werden. Gerade unter den klimawandelbedingten Dürrebedingungen müssen fatale
Folgen für Mensch und Ökosysteme befürchtet werden.
Die Reststoffe, die auf der Halde deponiert werden, bestehen aus scharfkantigem und teils lungengängigem Staub. Da die Deponie 60 Meter hoch werden soll und Winderosion ausgesetzt ist, wird die Gesundheit der Anwohner durch Staubverwehungen gefährdet. Da die bestehende Feinstaubbelastung in Breitenau, Liebenau und angrenzenden Ortschaften durch die Autobahn bereits hoch ist, werden die von der EU festgelegten neuen Grenzwerte voraussichtlich überschritten.
Mehr Informationen
Das Restgestein, das auf der Deponie in Liebenau gelagert werden soll, wird in den Planungsunterlagen als „sandartiger Reststoff“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein scharfkantiges und teils lungengefährdendes Material. Es fehlt eine Übersicht zu den Korngrößen der sogenannten „Reststoffe“. Auch deren chemische Zusammensetzung und damit einhergehende eventuelle Giftigkeit wird in den Unterlagen nicht ausgewiesen. Die Arsen-Belastung in unserer Region durch den Abraum des ehemaligen Zinn-Bergbaus, der demselben Gestein entstammt, lässt uns mit großer Sorge auf die geplante Halde schauen.
Die Trockendeponie soll bis zu 60 Meter hoch werden. Wie sie vor Verwehungen durch die teils erheblichen Winde auf den Höhenlagen um Liebenau geschützt werden soll, ist aus den Planungen nur unzureichend zu erkennen. Ein erheblicher Wasserverbrauch und dauernder Baggerbetrieb werden nötig sein, um Staubbelastungen, wie sie aus den früheren Jahren des Bergbaus in unserer Region bekannt sind, zu vermeiden.
Inakzeptabel ist, dass in den Planungsunterlagen die Wetterdaten einer viel tiefer gelegenen Wetterstation in Dresden-Klotzsche herangezogen wurden. Es heißt hier in der Unterlage D4, Seite 30: „Der Immissionsprognose liegt die Ausbreitungsklassenzeitreihe AKTerm der Station Dresden-Klotzsche zugrunde. Diese kann in erster Näherung für die Ausbreitungssituation herangezogen werden. Eine Übertragbarkeitsprüfung nach VDI 3783 Blatt 20 ist im Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Der Standort Altenberg verfügt auch über eine Messstation. Die Daten sind jedoch durch die Topografie stark beeinflusst und daher nicht als Grundlage für die Modellierung bei Einbindung der Topografie geeignet.“ Liebenau liegt ca. 360 Meter höher als Klotzsche und auf freiem Gelände nahe des Erzgebirgskamms. Hier treten vor allem in den Wintermonaten regelmäßig Stürme mit Windgeschwindigkeiten von über 60 km/h auf. Für eine Prognose der Staubverwehungen sind die Daten aus Klotzsche nicht zu verwenden. Wir befürchten, dass hier Gefahren bewusst verschwiegen werden. Im Radius von 5 Kilometern um die geplante Halde befinden sich die Orte Liebenau, Lauenstein, Bärenstein, Börnchen, Dittersdorf, Döbra, Waltersdorf, Hennersbach, Börnersdorf, Walddörfchen, Breitenau, Oelsen, Krasny Les, Fürstenwalde, Gottgetreu und Löwenhain. Hier ist mir erheblichen Staubbelastungen zu rechnen. Auch die Wasserqualität der Trinkwassertalsperre Gottleuba ist gefährdet, da in Liebenau häufig starke Südwestwinde vorherrschen, die Staub ins Trinkwasserschutzgebiet und zur Trinkwassertalsperre tragen würden. Zieht man die eher vergleichbaren Daten der Wetterstation Zinnwald-Georgenfeld heran, dann liegen die durchschnittlichen Windstärken fast ganzjährig über dem Grenzwert für Windverwehungen von Sand mit einer Korngröße 0,07 bis 0,5 mm. Eine Aufhaldung in Liebenau erscheint ohne erhebliche Verwehungen so gut wie unmöglich.
Zu den Staubbelastungen durch die Halde kommen die Feinstaubemissionen durch LKW-Verkehr und Werksbetrieb hinzu. Diese werden in den Planungen nur pauschal abgehandelt ohne verlässliche Schätzungen. Da die neuen Grenzwerte für Feinstaub in der EU sehr streng sind (Richtlinie 2024/2881) ist es aus unserer Sicht zwingend, die anliegende Feinstaubbelastung in den betroffenen Ortschaften, vor allem in Liebenau und Breitenau, im Vorfeld zu messen, um zu sehen, welche zusätzlichen Emissionen überhaupt möglich sind, ohne die gesetzlich festgelegten Grenzen zu überschreiten. Vor allem zu Feinstaub der Größe PM 2,5 und PM 10 liegen in Zinnwald keine Messwerte vor. Hier sind im Vorfeld Messungen in Liebenau und Breitenau zwingend erforderlich.
Die Lithiumaufarbeitungsanlage und die Halde sind in einer Region starker Hochwassergefährdung eine Bedrohung für Umwelt und Menschen. Hochwasserereignisse wie die vom Sommer 2002 würden zu Abbrüchen und Schlammausspülungen in der Deponie mit fatalen Folgen führen.
Mehr Informationen
Obwohl die geplanten Anlagen nur teilweise in ausgewiesenen Hochwasserentstehungsgebieten liegen werden, ist die Gefährdungslage in der Region hoch. Wie soll die Halde gegen Ausspülungen durch Niederschlagsereignisse wie die vom Sommer 2002 gesichert werden? Damals fielen in Zinnwald in 24 Stunden (am 12. 8. 2002) 312 Liter Regen pro Quadratmeter. Ausspülungen, Abbrüche oder Schlammlawinen aus der Halde wären eine Bedrohung für die angrenzenden Schutzgebiete im Trebnitzgrund und im Seidewitztal, sowie die Bewohner in Schlottwitz und den Ortschaften entlang der Müglitz und der Seidewitz. Gerade auf der Liebenauer Hochfläche entstand damals ein sehr hoher und schneller Abfluss in das vergleichsweise kleine Einzugsgebiet der Trebnitz. Die Wassermassen rauschten innerhalb kürzester Zeit bis in die nächste Ortslage, nach Schlottwitz. So trug die Trebnitz ganz erheblich zu den Zerstörungen 2002 in Schlottwitz bei. Eine großräumige Flächenversiegelung für eine Chemiefabrik und eine erosionsanfällige Lockermaterial-Halde im Quellgebiet der Trebnitz würden die Gefahren potenzieren. Ähnliches gilt für die hier auf der Hochfläche ebenfalls entspringende Seidewitz.
Auch die Betriebsanlagen selbst sind durch Extremwetterlagen gefährdet. Da das Unternehmen in seinen Planungen die Frage nach verwendeten Technologien und damit Chemikalien offenlässt, kann deren Gefährlichkeit nicht eingeschätzt werden und muss als sehr hoch angenommen werden.
Nach den vorliegenden Plänen beabsichtigt die Zinnwald Lithium GmbH auch, den Tunnel nach Liebenau direkt unter dem Hochwasserrückhaltebecken Lauenstein hindurchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass hier unter der Müglitzaue der Abstand zwischen Tunnel und Oberfläche – also auch der Gründung des Dammes – gering sein wird. Insbesondere im Hochwasserfall, wenn bis zu 5 Millionen m3 Wasser gegen den Damm drücken können, kann jede Verringerung der Stabilität verheerende Folgen haben.
Für den Transport der Zusatzstoffe und eventuell als Baustoff vermarkteten Abraums ist erheblicher LKW-Verkehr eingeplant. Die zu erwartenden Lärm- und Feinstaubbelastungen in Liebenau, Breitenau und angrenzenden Ortschaften sind in den Unterlagen nicht ausreichend nachgewiesen. Das derzeitige Straßennetz und die bestehende Verkehrsführung können die zu erwartende Verkehrsdichte nicht auffangen.
Mehr Informationen
Die Planungen der Zinnwald Lithium GmbH sehen einen erheblichen LKW-Verkehr auf dem Zubringer zur A 17, sowie vor allem in Liebenau und Lauenstein vor. LKWs sollen Zusatzstoffe, die teils Gefahrengut sind, in die Chemiefabrik bringen. Eventuell sollen an die Bauindustrie vermarktete Reststoffe in unbekannter Größenordnung abtransportiert werden. Das LKW-Aufkommen lässt sich nur schwer einschätzen, da bisher ausreichende Daten über das chemische Verfahren der Lithiumaufarbeitung fehlen.
Allein bei dem geplanten Tunnelbau entstehen ca. 420.000 m³ oder 845.000 t Gestein, die in Liebenau „zwischengelagert“ werden sollen. Soll der Tunnel wie in Variante 2 gebaut werden, fällt das Gestein an allen geplanten Mundlöchern in Zinnwald-Georgenfeld, Geising, Müglitztal (Löwenhain) und Liebenau an. Ca. 345.000 m³ oder 690.000 t müssen dann von Zinnwald-Georgenfeld, dem Mundloch Geising und dem Mundloch Müglitztal nach Liebenau „über das öffentliche Straßennetz“ transportiert werden. Das bedeutet beim Einsatz von 40-Tonnen-Lkws, die eine maximale Nutzlast von 25 bis 27 t besitzen, dass über 51.000 Lkw-Fahrten (voll hin + leer zurück) erforderlich sein werden. Das würde vollkommen das Straßennetz überlasten.
Es ist zu erwarten, dass zumindest in den Jahren bis zur Fertigstellung des Tunnels nach Liebenau (mindestens 4 Jahre, s. Unterlage C, S. 50), das Erz über den „Explorationsstollen“ ausgebracht und dann per Lkw zur Aufbereitungsanlage transportiert wird. Da aber jährlich 151.000 Tonnen Braunkohlenfilterasche (+ 179.000 t/a Gips) vermutlich als Bindemittel zum Versatz im Bergwerk angeliefert werden sollen (Unterlage B, S. 17, Tabelle 2), muss befürchtet werden, dass auch dieses Material per Lkw nach Zinnwald transportiert werden soll.
Das bestehende Straßennetz ist nicht mit den Planungen der Zinnwald Lithium GmbH vereinbar. In jedem Fall sind in der Prüfung folgende Verbote zu fordern: Samstags-, Sonntags- und Feiertagsfahrverbot, Nachtfahrverbot 22 bis 6 Uhr, Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge über 12 t durchgehend auf 30 km/h (insbesondere die starken Steigungs- und Gefällestrecken bilden ein hohes Risiko), Wintersperre. Denn zu beachten ist auch, dass der Autobahnzubringer zur A17 in den Wintermonaten regelmäßig durch Schneeverwehungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr befahrbar ist.
Ein Teil der LKW-Fahren werden Gefahrguttransporte darstellen. Der Gefahrstoff Lithiumhydroxid muss abtransportiert werden. Im Falle des „alkalischen Laugungsverfahrens“, das die technologische Grundlage für die Vormachbarkeitsstudie im vergangenen März bildete, käme noch der Antransport vermutlich großer Mengen von Salzsäure und Ätznatron hinzu. Das Trinkwasserschutzgebiet der Talsperre Gottleuba beginnt etwa 100 m südwestlich der geplanten Chemiefabrik in Liebenau, und so ist im Regionalplan 2020, Karte 6 (Boden- und Gewässergefährdung) die Region gekennzeichnet als „Gebiet mit hoher geologisch bedingter Grundwassergefährdung“. Im schlimmsten Fall muss auch mit Gefahrstoff-Havarien in einer Chemiefabrik gerechnet werden!
Generell halten wir es für außerordentlich kritisch, eine Chemiefabrik derartiger Dimension an einem Standort ohne Bahnanschluss zu planen. Die geplante Verkehrsführung würde das Leben der Anwohner und die Umwelt in einer Weise belasten, die aus raumordnerischer Sicht nicht akzeptabel ist.
Mehrere sensible Gewässer und wichtige Flora-Fauna-Habitate befinden sich in unmittelbarer Nähe der geplanten Chemieanlage. Die Wiesen bei Liebenau sind eine der wichtigsten Zugvogelschneisen Sachsens. Die geplante Überbauung der Trebnitzquelle und der erhebliche Flächenverbrauch stellen einen unverhältnismäßigen Eingriff in Natur und Landschaft dar.
Mehr Informationen
Die Liebenauer Hochfläche grenzt unmittelbar an das EU-Vogelschutzgebiet Fürstenau an. Außerdem beginnen hier die Täler von Trebnitz, Seidewitz und Gottleuba. Alle drei gehören zum SPA-Gebiet „Osterzgebirgstäler“. Die habitatnahe Flugdistanz der meisten Ziel-Vogelarten in den Schutzgebieten ist berührt. Bei dem für die Chemiefabrik und die Abraumhalde vorgesehenen Gebiet handelt es sich um eine Art Knotenpunkt im Kohärenzsystem zwischen den Vogelschutzgebieten. Zahlreiche Arten nutzen die Quellgebiete von Trebnitz und Seidewitz als Nahrungsflächen, insbesondere Bodenbrüter (Feldlerche, Kiebitz) in nicht unerheblichem Maße auch als Brutgebiet. Die Wiesen stellen eine der wichtigsten Zugvogelschneisen in Sachsen dar. Viele Zugvögel rasten hier.
In den Unterlagen heißt es: „Die Erheblichkeit des potenziellen Konfliktes durch die ABA/D kann erst nach umfänglichen faunistischen Untersuchungen beurteilt werden“ (Unterlage C, S. 59f.). Diese Aussage kann nur bedeuten: So lange die „Erheblichkeit potenzieller Konflikte“ nicht ausgeschlossen werden kann, ist auch keine Feststellung einer „Raumverträglichkeit“ möglich. Weiter kann man lesen: „Hinweis zur Verträglichkeit für FFH-Gebiete und SPA (Natura 2000): Die Verträglichkeit der Konflikte auf Natura 2000-Gebiete kann erst in einem späteren Planungsstadium anhand detaillierter technischer und baubetrieblicher Planung begutachtet werden“ (Unterlage C, S.80). Faktisch kann auch dies nur heißen: Dem Vorhaben kann bei jetzigem Planungsstand keine Raumverträglichkeit beschieden werden!
Die Aufhaldung der Reststoffe stellt eine Gefährdung der hier entspringenden Gewässer (Trebnitz und Seidewitz) dar. Wie sichergestellt werden soll, dass unter keinen Umständen Schadstoffe aus der Deponie in Grund- und Fließgewässer gelangen, bleibt in den Planungsunterlagen weitestgehend offen. Welche Konsequenzen hier die fehlende Vorsorge hat, kann man im Tal der Kleinen Biela unterhalb der Spülkippe von Zinnerz Altenberg sehen, wo sich schwermetallbelastete Schlämme abgelagert haben. Aktuell wird hier für mehrere Millionen Euro eine Sickerwasser-Reinigungsanlage gebaut, um insbesondere die hohe Arsenbelastung zu reduzieren. Dasselbe Gestein soll jetzt in Liebenau abgelagert werden. Die einzige Aussage, die in den ROV-Unterlagen zu diesem außerordentlich wichtigen, sehr raumbedeutsamen Themenkomplex zu finden ist, lautet: „Bei der Planung wird derzeit eine Basisabdichtung geprüft.“ (Unterlage B, S. 15) Das ist völlig unzureichend.
Die Darstellung der „Konflikte mit Potenzial erheblicher Umweltauswirkungen“ (Unterlage A, Tabelle 13; außerdem Unterlagen C und D1) in Form von Rot-Gelb-Grün-Ampeln mag eingänglich wirken, zugrunde liegen aber zumeist kaum nachvollziehbare gutachterliche Einschätzungen. Die Datengrundlagen zur Naturausstattung sind de facto mangelhaft. So liegen die letzten Offenland-Biotopkartierungen der Region um Liebenau mehr als 20 Jahre zurück. Vor einer Prüfung der Raumverträglichkeit der riesigen Chemieanlage müssen gründliche Datenerhebungen gemacht werden.
Bei der Liebenauer Hochfläche handelt es sich laut Regionalplanung um ein „Vorranggebiet Landwirtschaft“ sowie ein „Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz“. Zu erwarten wäre nicht nur die direkte Vernichtung von mehr als einem Quadratkilometer Agrarfläche mit fruchtbaren Böden, sondern auch ein sehr hohes Risiko kaum reversibler Kontaminierung umgebender Bereiche. Bei der Beschreibung des FFH-Gebiets Trebnitzgrund (41E) bleibt der Bachlauf selbst unerwähnt. Die Trebnitz ist in ihrer gesamten Länge innerhalb des Gebiets als Lebensraumtyp 3260 (Fließgewässer mit Unterwasservegetation) eingestuft und maßgeblich wertbestimmend. Die herausragende Naturschutzbedeutung resultiert nicht zuletzt auch daraus, dass die Trebnitz noch nie durch Bergbauabwässer belastet wurde. Refugien wie der Trebnitz ist es zu verdanken, dass sich Fische und Wirbellose das Fließgewässersystem der Müglitz in den letzten Jahren zurückerobern konnten. Die Errichtung der Halde im Quellgebiet und die voraussichtlich großen Mengen kontaminierter Abwässer/Bergbauschlämme würde die Totalentwertung dieses bedeutenden Gewässer-Ökosystems bedeuten.
Da sich auf den Wiesen, wo die Halde und die Chemieanlage geplant sind, die Quell- bzw. Einzugsgebiete von drei sehr bedeutenden, naturnahen Fließgewässerökosystemen berühren, haben sie für Tierarten, die entlang der Bachtäler wandern (insbesondere Fischotter, aber wahrscheinlich auch verschiedene Kleintiere) eine große Bedeutung. Die von Moorbirkenwäldchen und Feuchtbiotopen geprägten Flächen können als Knotenpunkte gelten. Das Gleiche gilt möglicherweise auch für Fledermäuse, die sich auf ihrem Weg zwischen Teilhabitaten an langgestreckten Landschaftsstrukturen (z.B. die Waldränder oberhalb der Taleinschnitte) orientieren.
„Für die Depotflächen ist geplant, diese stückweise als landschaftsgestaltetes Grünland einer Nachnutzung zuzuführen. Hierbei ist sowohl eine stückweise Flächeninanspruchnahme
neuer Flächen wie auch die Rückgabe bereits rekultivierter Flächen geplant." (Unterlage B, S.18) Aufgrund des erwartbar hohen Anteils toxischer Bestandteile im Haldenmaterial wird eine landwirtschaftliche Nutzung ggf. rekultivierten Grünlands auf der Halde ausgeschlossen sein, insofern diese nicht mit erheblichen Massen unbelasteten Mutterbodens abgedeckt wird. Eine derartige Haldensanierung ist teuer. Laut PFS (S.29) sollen für die gesamten „closure costs“ des Unternehmens lediglich 11 Mio Euro zurückgestellt werden. Dies ist viel zu niedrig. Vom Unternehmen sind hier im Zug der Raumverträglichkeitsprüfung Klarstellungen zu fordern!
Auszugehen ist von erheblichen Lärm- und Lichtbelastungen, die das Leben in Liebenau und rund um die Halde extrem beeinträchtigen werden.
Mehr Informationen
Angesichts von Gebäudehöhen in der geplanten Chemiefabrik von 40 m und der Höhe der Deponie von 60 m auf einer ohnehin freien Hochfläche muss man von ungehinderter Ausbreitung von Lärm und Licht ausgehen. Der Lärmpegel der A 17 kommt hinzu. Die Schlussfolgerung des Unternehmens: „Konflikte sind somit nicht zu erwarten“ (Unterlage C, S.43), ist falsch. Was werden die Anwohner sagen, wenn Tag und Nacht die Bagger rollen? Denn um das Verwehen der potentiell toxischen Staubmassen zu verhindern, wird der pausenlose Einsatz von schwerer Technik unvermeidlich sein. Die „schalltechnische Stellungnahme“ (Unterlage D3) muss dringend durch einen unabhängigen Sachverständigen einer gründlichen Prüfung unterzogen werden.
In der Unterlage C. S.125 heißt es: „Betriebsbedingt kommt es insbesondere durch die dauerhafte Beleuchtung des Betriebsgeländes der Aufbereitungsanlage und den Betrieb des Depots zu Lichtemissionen.“ Die nächtlichen Lichtemissionen der 40 m hohen Chemiefabrik sowie der vermutlich ebenfalls beleuchteten Halde werden weit über den für die ROV-Untersuchungen veranschlagten „Pufferbereich“ von 1.000 m (Unterlage C, S.22) großräumige Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen, die nachtaktive Fauna und das Erscheinungsbild der Landschaft haben. In den Ortschaften Breitenau, Walddörfchen und Liebenau wird es nachts nicht mehr dunkel werden.
Seit Jahren setzt die Region auf sanften und naturnahen Tourismus. Das Osterzgebirge steht für schöne Wander- und Skigebiete. Eine geplante Industrieanlage dieser Größenordnung, die aus allen Sichtachsen landschaftsverändernd sein wird und genau an den Zufahrtswegen zu den Tourismuszentren liegt, würde die ökonomische Existenz vieler Menschen gefährden.
Mehr Informationen
Eine Chemiefabrik und Halde von diesen Dimensionen ist für den Naturraum Ost-Erzgebirge völlig untypisch und würde eine verfremdende technische Landmarke darstellen, die von der Liebenauer Höhe aus bis weit ins Elbtal und in die Sächsische Schweiz auffallen würde. „In dem Reisegebiet Erzgebirge werden übertätige Anlagen durch ABA/D und die Varianten 2 und 3 für den Rohstofftransport errichtet. Die touristische Attraktivität kann durch Anlagen an der Oberfläche beeinträchtigt werden. Das Seidewitztal liegt ca. 2 km nördlich der ABA/D. Eine Beeinflussung der Erholungswirkung ist auf Grund der Entfernung nicht zu erwarten. Es ergibt sich somit keine raumbedeutsame Beeinträchtigung durch das Vorhaben.“ (Unterlage C, S. 46) Aus nicht nachvollziehbaren Gründen picken sich die Autoren der Unterlagen willkürlich das Seidewitztal als Beleg heraus. Dabei wären die Anlagen auf dem Höhenrücken vielerorts und weithin zu sehen und zu hören. Sie würden die meisten Aussichten an der Ostflanke des Ost-Erzgebirges dominieren und das Wandern oder Radfahren etwa auf der Alten Dresden-Teplitzer Poststraße, auf der „Hohen Tour“ oder dem Europäischen Fernwanderweg E3/EB im Naturerleben stark beeinträchtigen. Anders als auf S. 68, Unterlage C, suggeriert, würden die (nachts auch beleuchteten) Industrieanlagen nicht nur den Ausblick von den wenigen in den Planungsunterlagen genannten „landschaftsprägenden Erhebungen“ dominieren, sondern auch von vielen weiteren beliebten Rast- und Aussichtspunkten (z.B. Traugotthöhe, Schafkuppe, Pfarrhöhe, Oelsener Höhe).
In den Planungen findet sich keine ausreichende Variantenprüfung. Insbesondere der mögliche Transport des Gesteins mit der Müglitztalbahn zu einem bestehenden Industriekomplex zur Aufarbeitung und die Deponierungen der Roststoffe in einem der Restlöcher des Braunkohletagebaus wurde nicht ausreichend geprüft.
Mehr Informationen
In den Planungen findet sich nur eine oberflächliche Variantenprüfung, die für eine Raumverträglichkeitsprüfung völlig unzureichend ist und von wenig Weitblick und Innovationskraft des Unternehmens zeugt. Als Standorte für die chemische Aufbereitung und Deponierung wurden nur die Varianten Bärenstein und Liebenau verglichen, nachdem aus wirtschaftlichen Erwägungen die Ursprungsvariante Altenberg nicht weiter verfolgt wurde. Es ist jedoch falsch, zu postulieren: „Weitere Alternativen stehen aufgrund des notwendigen Flächenbedarfs und der erforderlichen Nähe zur Gewinnung nicht zur Verfügung.“ (Unterlage A, S.7). Tatsächlich drängen sich weitere Varianten auf. Eine naheliegende Kooperation mit dem Konkurrenzunternehmen auf der tschechischen Seite scheint nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden zu sein. Vor allem aber ist zu hinterfragen, ob die chemische Aufarbeitung und die Deponierung wirklich in dem sensiblen Naturraum Ost-Erzgebirge geschehen müssen. Der Transport des abgebauten Gesteins zu einem bestehenden Industriekomplex außerhalb des Ost-Erzgebirges, um dort die chemische Verarbeitung vorzunehmen, und die Ablagerung der Reststoffe in einem der Restlöcher des Braunkohlebergbaus ist eine Variante, die umfassend geprüft werden muss. Für den Transport muss dafür die Nutzbarkeit der Müglitztalbahn und eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn geprüft werden. Das würde auch eine enorme umweltpolitische Aufwertung des Vorhabens darstellen.
Die Kapazität der Flächen in Liebenau ist viel zu gering und reicht laut Planungen nur für einen Teil der Produktionszeit. Es fehlen Planungen für den Verbleib großer Teile der Reststoffe.
Mehr Informationen
75 Hektar groß und 60 m hoch (Unterlage B, S. 15) soll die Halde in Liebenau werden. So landschaftsprägend sie auch sein wird, zeigen doch schon grobe Berechnungen, dass hier niemals alle Abprodukte eines 1,5 Mio t pro Jahr fördernden Bergwerksbetriebs Platz finden können. Geht man von einem Kegel von 750.000 m2 Grundfläche und 60 m Höhe aus, ergeben sich 4,5 Mio m3. Bei einer Dichte feuchten Feinsandes von rund 2 kg/m3 ergibt das eine theoretische Haldenkapazität von 9 Mio t. Bei einer Jahresförderung von 1,5 Mio t Erz und Rückführung von 50 % Versatz würde dies für eine Betriebsdauer von lediglich zwölf Jahren reichen, geplant sind aber 40 Jahre. Da aber die Halde vermutlich kein regelmäßiger Kegel sein kann, sondern es sich um einen abgestuften Stumpf handeln wird, dessen Böschungs-Schüttwinkel gesetzlich (bei Haldenhöhen von 35 m) auf 21,8° begrenzt ist, wird die reale Kapazität viel geringer sein. Wo soll der viele Abraum nach der Ausschöpfung der Haldenkapazität verkappt werden? Eine Vermarktung des gesundheitlich problematischen und heterogenen Staubs in der Baustoffindustrie ist bisher nur Wunschdenken. Für die veranschlagte Betriebszeit werden also zwei zusätzliche Halden ähnlicher Dimension benötigt – oder aber der Flächenbedarf auf der Liebenauer Hochfläche wird nachträglich erheblich nach oben korrigiert werden müssen. Die Raumverträglichkeit des Vorhabens kann ohne zuverlässige Angaben über die Aufhaldung der Reststoffe durch die Zinnwald Lithium GmbH aus unserer Sicht nicht zuerkannt werden.
Innerhalb der Planungsunterlagen der Zinnwald Lithium GmbH gibt es zahlreiche Widersprüche. Vor allem die Abtrennung der geplanten Phase II in den Unterlagen zur Raumverträglichkeitsprüfung stellt eine unzulässige „Salamitaktik“ dar.
Mehr Informationen
Nach der Pre-Feasibility Study der Zinnwald Lithium GmbH vom März 2025 ist die Wirtschaftlichkeit des gesamten Vorhabens nur mit einer Phase 2 des Lithiumabbaus gegeben, in der die Fördermengen verdoppelt werden sollen (PFS S. 7). In den RVP-Unterlagen lässt man die Kapazitätserhöhung offen: „Derzeit wird von einer möglichen jährlichen Förderkapazität von 1.500.000 t Lithiumerz ausgegangen.“ (Unterlage A, S. 11) Das ist nicht nur insofern kritisch, als sich das Problem der Abraummengen noch deutlich verschärfen würden. Auch die „Financial / economic analysis“ der Pre-Feasibility Study geht für die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projekts von mind. 3,2 Mio t / a Erzförderung aus (PFS S. 31). Das heißt also, dass bei einer Fördermenge von 1,5 Mio t / a keine Wirtschaftlichkeit des Abbaus gegeben ist. Wieso beziehen sich dann die Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung nur auf die Fördermengen der Phase 1? Es handelt sich um eine unzulässige „Salamitaktik“.
Widersprüchlich sind auch die Angaben zum technischen Verfahren, das in der Aufarbeitung angewendet werden soll. In der Pre-Feasibility Study angeführt Sowohl und in der Öffentlichkeitsarbeit wiederholt gepriesen wird von der Zinnwald Lithium GmbH das „alkalische Laugungsverfahren“, das allerdings offenbar noch weit von der Praxistauglichkeit entfernt zu sein scheint. Stattdessen wird hier wieder der klassische Sulfatprozess zugrunde gelegt (Unterlage B, S. 13f). Beide Verfahren unterschieden sich sehr wesentlich hinsichtlich Wasser-, Energie- und sonstigem Ressourcenverbrauch sowie der entstehenden Abprodukte, was auch im Raumordnungsverfahren nicht unberücksichtigt bleiben darf. Eine Raumverträglichkeit des Vorhabens kann ohne Klarheit über das chemische Verfahren schwerlich zuerkannt werden. Diese Inkonsistenz spiegelt sich an verschiedenen Stellen in den Planungunterlagen: „Im Ergebnis liegt Lithium nach der Aktivierung im Röstprodukt als sehr gut wasserlösliches Lithiumsulfat vor.“ (Unterlage B, S. 14). Wenige Seiten später steht in Tabelle 2 aber „Lithiumhydroxid-Monohydrat“ als abzutransportierendes Produkt (Unterlage B, S. 17). Was ist nun richtig? In beiden Fällen handelt es sich um Gefahrenstoffe, jedoch teilweise unterschiedlicher Klassifizierung, die entsprechend unterschiedliche Vorsorgemaßnahmen bei Transport, Lagerung und Handhabung erfordern.
Das Vorhaben steht im Konflikt zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Region, in der Tourismus, Sport und Gesundheit eine wesentliche Rolle spielen. Es gefährdet Arbeitsplätze und Entwicklungsperspektiven. Das arrogante und profitgetriebene Auftreten des Unternehmens vor Ort hat viel Vertrauen zerstört. In einer ohnehin brüchigen Situation wird durch das Vorhaben der Bestand des demokratischen Gemeinwesens gefährdet
Mehr Informationen
Immer wieder heißt es in den Planungsunterlagen: „Das Vorhaben trägt zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in einem ländlichen Raum bei ...“ (Unterlage C, S. 47) Worauf bezieht sich diese Behauptung? Die vage Verheißung neuer Arbeitsplätze ist wenig tragfähig in einer Region, die mit akutem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. „Neue Arbeitsplätze“ würden zulasten der ortsansässigen Unternehmen gehen. Die Felder wirtschaftlicher Entwicklung, in die in den letzten drei Jahrzehnten am meisten investiert wurde, insbesondere der naturnahe Tourismus, das Kur- und Erholungswesen und naturverträgliche Landwirtschaft, werden in ihrem Bestand gefährdet.
Die lokale Identität und kulturelle Prägung der Region hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr gewandelt. Altenberg verfügt über Kurort-Status und ist als Sportstätte weithin bekannt. Zinnwald ist staatlich anerkannter Erholungsort. Bad Gottleuba ist geprägt vom Kur- und Gesundheitswesen. Im historischen Waldhufendorf Liebenau, wo nun Chemiefabrik und Abraumhalde die Landschaft verunstalten sollen, hat es auch in der Vergangenheit nie nennenswerten Bergbau, und schon gar nicht Großindustrie gegeben. Dass sich hier ein sehr hohes soziales Konfliktpotential abzeichnet, belegte die einhellige Ablehnung der Pläne durch die Liebenauer bei einer formellen Bürgerbefragung im April 2024.
Die Zinnwald Lihtium GmbH hat weder die EU-Anerkennung als strategisches Projekt gemäß Critical Raw Materials Act noch eine Förderzusage des Bunds entsprechend der Förderrichtlinie zur Stärkung von Batterie-Wertschöpfungsketten bekommen. Das hat Gründe. Um das Unternehmen doch noch irgendwie profitabel darstellen zu können, wurde das Vorhaben immer weiter aufgebläht und die Fördermenge in der Planung erhöht. Selbst dann würde erst eine Vervielfachung des Lithium-Preises die Wirtschaftlichkeit der Förderung bedeuten, so die Einschätzung in den Planungen der Vormachbarkeitsstudie. Die Lithiumgehalte im Granitstock Zinnwald sind extrem gering im internationalen Vergleich von Festgesteinsvorkommen. Es ist zu fragen, ob der enorme Landschaftsverbrauch, drohende soziale Verwerfungen und ökologische Folgen verhältnismäßig sind.
Die geplanten Maßnehmen stehen in klarem Widerspruch zu einer nachhaltigen und umweltgerechten Raumordnung im Osterzgebirge. Das Vorhaben ist ökologisch riskant. Es gefährdet die sozialen Strukturen und natürlichen Ressourcen in der Region. Es ist mit erheblichen Gesundheitsgefahren verbunden.
Wir lehnen das Projekt ab und fordern die Landesdirektion Sachsen auf, dem Projekt in der vorliegenden Form keine Raumverträglichkeit zu attestieren.
Weiterführende Informationen:
| Voriger Beitrag | Zurück zur Übersicht | Nächster Beitrag |